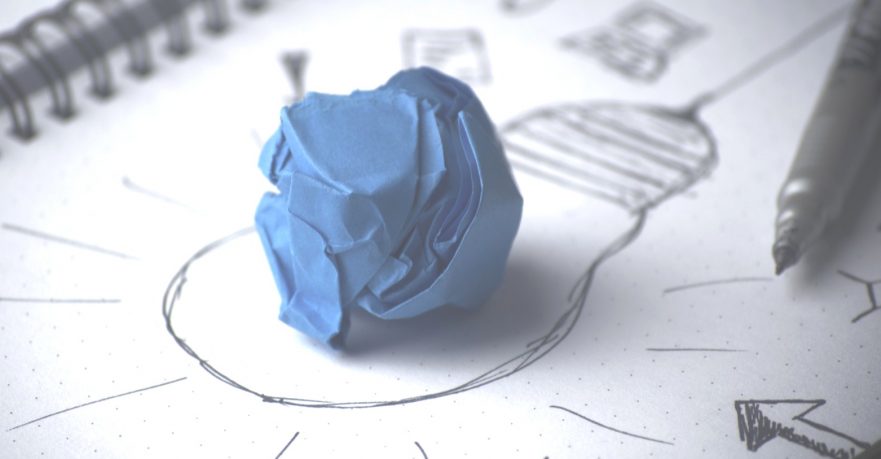Verschiedentlich ist es eng geworden in den letzten Monaten. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Vorbei die Zeiten, als sich die vierköpfige Familie nach dem gemeinsamen Frühstück noch in alle Himmelsrichtungen verteilte. Man ist wieder Mal zusammengerückt – notgedrungen, das Virus lässt grüßen. Die Kita geschlossen, Schule auf Distanz und Büroarbeit von zuhause. Eine Situation, die den Betroffenen einiges abverlangt. Viele berufstätige Eltern können ein Lied davon singen. Die tägliche Jonglage zwischen virtuellen Kundenmeetings, Unterrichtsersatzdienst und Kinderbespaßung zehrt an den Kräften. Um in dieser Melange aus beruflichen Herausforderungen und privaten Belangen den Kopf oben zu behalten, braucht es eine gute Organisation und bisweilen auch starke Nerven.
Arbeitswelt im Wandel
Dennoch, wenn wir eines mitnehmen können aus dieser Krise, dann ist es die Erkenntnis, dass Homeoffice grundsätzlich funktioniert. Ganz sicher auch in post-pandemischen Zeiten. Laut einer Studie der Uni Konstanz haben jedenfalls 26 Prozent der dort befragten Beschäftigten den Wunsch geäußert, zwei Tage in der Woche von zuhause aus zu arbeiten. 20 Prozent könnten sich sogar mit einer 5-Tage-Woche am heimischen Schreibtisch anfreunden. Zudem ist die Option Homeoffice auch bei der Arbeitgeberwahl ein durchaus beachtetes Kriterium. Es hat ja auch Vorteile – keine lästigen Wege, keine Lebenszeitverschwendung in schrittfahrenden Blechlawinen und einen wahrscheinlich weniger stressigen Start in den Arbeitstag. Es ist, wie es ist und eigentlich war es absehbar: Homeoffice wird zukünftig vermehrt Einzug halten in unsere Arbeitswelt. Die Pandemie wirkt hier als eine Art Katalysator. Dass Unternehmen dieser Entwicklung zum Teil noch mit einer gewissen Skepsis begegnen, hat nicht unbedingt etwas mit der Angst vor einem Kontrollverlust zu tun. Was sie vielmehr umtreibt, ist die Frage nach der Sicherheit.
Sicherheit geht vor
Fallstricke lauern überall. Verlorene USB-Sticks mit Kundendaten, Personalakten, die sich frei zugänglich auf dem Küchentisch stapeln, Vertragsentwürfe, die in der halb geöffneten Altpapiertonne entsorgt werden und Laptops, die wechselweise für die Büroarbeit und für´s Gaming genutzt werden. Ein Horrorszenarium, das jedem Datenschutzbeauftragten wohl die Schweißperlen auf die Stirn treibt. Es muss ja nicht gleich so dicke kommen. Klar ist aber: Wer sich nicht intensiv mit Fragen der Datensicherung beschäftigt, kann schnell in die Bredouille geraten. Was es braucht, ist ein ausdifferenziertes Datenschutzmanagement. Das fängt bei der Sensibilisierung der Mitarbeiter an, beinhaltet organisatorische sowie technisch-infrastrukturelle Maßnahmen und mündet in einer Homeoffice-Vereinbarung als Zusatz zum Arbeitsvertrag. Denn nicht zuletzt geht es im Zweifel auch um haftungsrechtliche Fragen.
Auf dünnem Eis
Es ist zu befürchten, dass sich an dieser Stelle viele Unternehmen während des zweiten Lockdowns immer noch auf recht dünnem Eis bewegen – insbesondere dann, wenn Beschäftigte ihre eigenen Endgeräte auch für dienstliche Zwecke nutzen. Wer Homeoffice aber jenseits der Krise als lohnenswertes Modell für die Zukunft verfolgt, sollte hier schnell nacharbeiten. Zumal das Thema nach der Gesetzesinitiative von Bundesarbeitsminister Heil kurzfristig noch an Dynamik gewinnen kann. Wer Anleitung braucht: Tiefgehende sachdienliche Hinweise zu allen sicherheitsrelevanten Aspekten finden sich etwa im IT-Grundschutz-Kompendium des BSI.
Bild: Pixabay