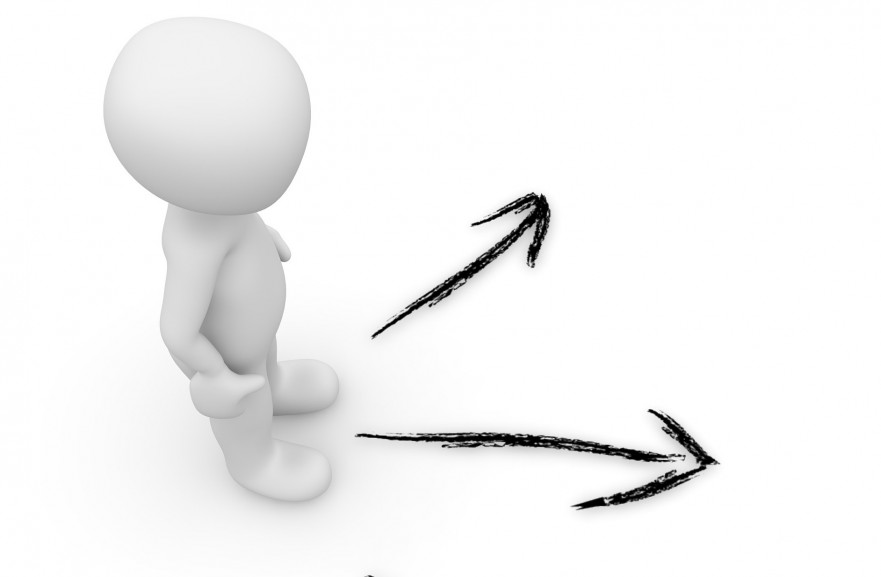Die direkte Ansprache von Jobkandidaten ist wahrhaftig kein neues Tool im Instrumenten-Portfolio des Recruitments, geschweige denn ein neuer Trend. Es gab sie schon immer, bei der Besetzung von Führungspositionen oder auch im Rahmen von Absolventenkongressen und Campusveranstaltungen. Insofern geht es hier um nichts grundsätzlich Neues. Allerdings haben sich die Rahmenbedingungen für das Active Sourcing in den letzten Jahren doch grundlegend verändert. Stichwort: Demographischer Wandel und Fachkräftemangel.
Beides zwingt Personaler im Zweifel dazu, sich bei der Personalbeschaffung grundlegend neu zu orientieren – jedenfalls dann, wenn sie im Wettbewerb um die hellsten Köpfe nicht das Nachsehen haben wollen. Sich ausschließlich darauf zu verlassen, dass einer geschalteten Anzeige dutzendfach Bewerbungen bestens geeigneter Kandidaten folgen, dürfte die adäquate Besetzung vakanter Positionen in vielen Fällen zukünftig erschweren. Recruiter sind vielmehr aufgefordert, ihre Post & Pray-Komfortzone zu verlassen, das heißt, selber aktiv zu werden und Initiative zu ergreifen. Dafür sprechen im Übrigen auch Ergebnisse aus der Studienreihe „Recruiting Trends 2016“, nach denen 45 Prozent der Stellensuchenden und Karriereinteressierten die persönliche Ansprache durch ein Unternehmen, der selbständigen Bewerbung gegenüber präferieren.
Social Media eröffnen Chancen
Einhergehend mit der immer weiter fortschreitenden Digitalisierung unseres Alltags und mit der Verbreitung von Sozialen Medien eröffnen sich für das Recruiting zudem gänzlich neue Möglichkeiten. Längst hat sich Social Recruiting, das heißt das gezielte Nutzen von sozialen Medien für das Gewinnen von Personal, als Fachterminus etabliert. Und dabei geht es eben nicht nur darum, dass Informationen über vakante Positionen – etwa in Form von Online-Stellenanzeigen – gezielt gestreut und die Verbreitungsmechanismen sozialer Medien ebenso gezielt genutzt werden. Business-Netzwerke wie Xing oder LinkedIn und soziale Plattformen wie Facebook bieten eine Datenbasis, die sich für das Active Sourcing, also die Identifikation und direkte Ansprache vielversprechender Kandidaten bestens nutzen lässt. Bereitwillig legen User aller Altersklassen heute persönliche Profile an und geben mehr oder weniger detailliert Auskunft, nicht nur über die berufsbezogene Vita, sondern auch über sonstige private Vorlieben und Interessen. Für das Recruiting doch eigentlich ganz gute Voraussetzungen, sollte man meinen. Vielfach bleibt das Potenzial allerdings noch ungenutzt, gerade im Kontext des Active Sourcing. So werden etwa die Netzwerke Xing und LinkedIn laut der Recruiting-Trendstudie branchenübergreifend nur von 14,9 bzw. 10,6 Prozent der befragten Unternehmen für die Kandidatensuche genutzt.
Personalisierte Ansprachen bleiben unerlässlich
Möglicherweise übt man sich an dieser Stelle noch in Zurückhaltung, weil man doch den zeitlichen und monetären Aufwand scheut. Denn eines ist klar, auch wenn die Business-Netzwerke Unternehmen und Personalberater bei ihren E-Sourcing-Bemühungen mit technischen Lösungen unterstützen, einfach per Knopfdruck wird auch hier nicht mal eben die Idealbesetzung „ausgespuckt“. Das Active Sourcing erfordert immer eine genauere Analyse der Profile, die auf Basis von vorgegebenen Filterkriterien selektiert werden. Und das gilt erst recht, wenn es um eine personalisierte Ansprache geht. Wer sich die Mühe nicht machen will, kann natürlich nach dem Gießkannenprinzip hunderte potenzielle Mitarbeiter mit dem gleichen Standardschreiben bedienen, wirklich erfolgversprechend ist das allerdings nicht. Kontaktanbahnungen dieser Art führen eher zu Verärgerung und landen genauso schnell im virtuellen Papierkorb, wie sie verschickt worden sind. Besonders nachgefragte Fachkräfte, vor allem Ingenieure und Informatiker, können von solch falsch verstandenen, wenig professionellen Active Sourcing-Bemühungen unterdessen schon ein Lied singen. Aber auch wenn einige Bereiche schon als „überfischt“ bezeichnet werden, grundsätzlich bieten die bekannten Business-, aber auch andere soziale Netzwerke mit Millionen von Nutzern alleine im deutschsprachigen Gebiet, hervorragende Anknüpfungspunkte für Active Sourcing.
Allerdings sollten sich Recruiter auch nicht von den technologischen Möglichkeiten blenden lassen und allzu blauäugig ans Werk gehen. Allen, auch anderen Social Recruiting-Aktivitäten sollte zu allererst eine genaue Analyse vorangehen. Die zentrale Frage lautet demnach: Welche Kanäle werden von der anvisierten Zielgruppe denn überhaupt genutzt? Im Zweifel kann ein Engagement jenseits von Xing & Co. nämlich durchaus mehr Sinn machen. Ob ein Direktkontakt in der Konsequenz aber Erfolg hat, dürfte bei aller Sorgfalt in der Zielgruppenanalyse doch entscheidend von der Form der Ansprache abhängen. Individualisiert, persönlich und an der Vita des Kandidaten orientiert, sollte sie sein. Was der Recruiter an diese Stelle also mitbringen muss, ist nicht nur eine gewisse Medienkompetenz, sondern auch Fingerspitzengefühl und soziale Fertigkeiten. Hier schließt sich dann der Kreis zwischen analoger und digitaler Recruiting-Welt.
Quelle Beitragsbild: Pixabay