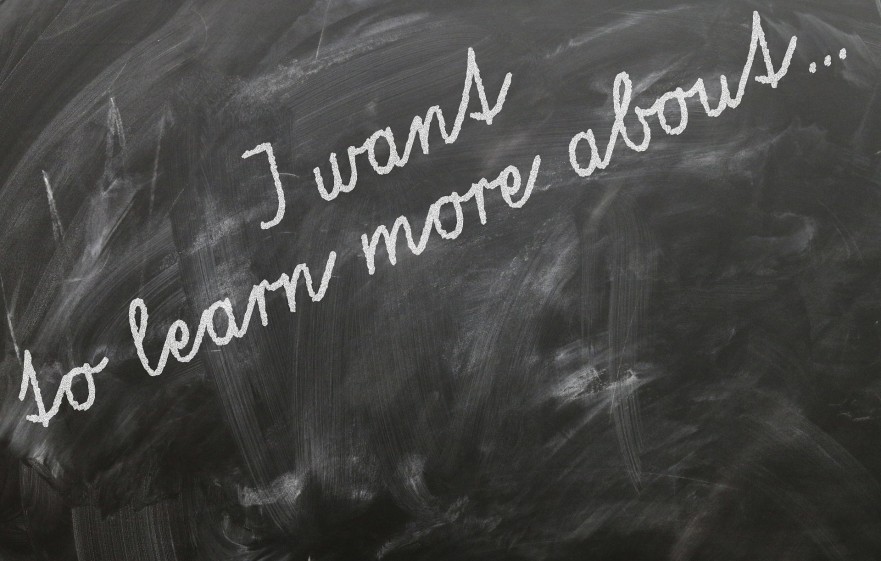Sie kennen das vielleicht. Das Klassentreffen steht vor der Tür und sie gehen in Gedanken die Sitzreihen ihres alten Klassenraumes durch. Wenn es gut läuft, fallen ihnen zu den Gesichtern, die vor ihrem geistigen Auge auftauchen, sogar noch die richtigen Namen ein. Sie werden neugierig und wollen mehr wissen. Was macht er denn heute so, ihr ehemals bester Freund? Wie sieht er aus? Hat er Familie? Und, und, und… . Blieben all diese Fragen früher noch bis zur Wiedersehensparty unbeantwortet, sind wir heute im Vorfeld des abendlichen Smalltalk-Marathons bereits bestens präpariert. Denn wir waren online, haben Suchmaschinen bemüht und ausdauernd in sozialen Netzwerken gestöbert.
Die Professionalisierung eines Rituals
Während uns die Online-Recherche von personenbezogenen Informationen im privaten Bereich schon zum lieb gewordenen Ritual geworden ist, hat die Methode unter dem Schlagwort Kandidatencheck oder Neu-Deutsch Pre-Employment-Screening (PES) längst auch Einzug ins Personalwesen gehalten. Und irgendwie wäre es ja auch seltsam, wenn sich ausgerechnet Recruiter die vielfältigen Möglichkeiten der digitalen Informationsbeschaffung nicht zu Nutze machen würden. Aber ist eigentlich alles erlaubt, was möglich ist? Wie sieht es aus, wenn wissensdurstige Personaler mit detektivischem Eifer in die Online-Welt eintauchen, um sich ein möglichst lückenloses Bild von ihrem Kandidaten zu machen? Der Mensch ist ja neugierig und die Aussicht, sich mit wenigen Klicks mal eben schlauer zu googeln, ist doch zu verlockend. Grundsätzlich bewegt man sich mit dieser Art digitalem Schnelltest wohl auf rechtssicherem Terrain, solange nicht Daten ausgewertet werden, die offensichtlich gegen den Willen eines Bewerbers online gestellt wurden. Sollten hier Zweifel bestehen, lassen sie lieber die Finger davon.
Der Bestbesetzung auf der Spur
Beliebter Anlaufpunkt für digitale Recherchebemühungen sind natürlich die populären beruflichen Netzwerke – im Übrigen auch bei der Suche nach geeigneten Kandidaten im Rahmen des vielfach als Königsweg propagierten Active Sourcing. So informieren sich einer Studie des Verbandes BITKOM zufolge, gut zwei Drittel der Personaler in sozialen Netzwerken über Bewerber, wenngleich es bei der großen Mehrheit (81 Prozent) der befragten Unternehmen keine verbindlichen Regelungen dafür gibt. Das „Anzapfen“ von Xing & Co. dürfte dabei unter Datenschutzgesichtspunkten auch in Zeiten der DSGVO unverdächtig sein. Denn jeder User hat schließlich über die AGB seine Einwilligung dazu gegeben, dass andere beruflich motivierte Plattformnutzer ihre Daten einsehen können. Und es liegt ja auch in der Natur der Sache: Jemand, der sich hier exponiert, macht das bewusst und bezweckt etwas. Er will Geschäfte machen, einfach nur seinen eigenen Marktwert testen, oder eben als mögliche Besetzung für eine vakante Stelle angesprochen werden. Das Gesehen- und Kontaktiertwerden ist also in der Regel nicht nur toleriert, sondern gewollt. Unternehmen, die in puncto Datenschutz auf Nummer sicher gehen wollen, beschränken ihre Aktivitäten deshalb am besten auch auf die beruflichen, nicht primär zu privaten Zwecken genutzten Netzwerke.
Regeln und Sensibilität
Grundsätzlich sollten für Backgroundchecks und Active Sourcing klare, verbindliche Vorgaben gemacht werden. Personalern muss klar sein, wo sie in welchem Umfang tätig werden dürfen und welche datenschutzrechtlichen Bestimmungen dabei zu beachten sind. Wer andererseits den virtuellen Raum zur Selbstdarstellung nutzt, soziale Profile anlegt und ansonsten auch fleißig postet, tut das besser in der Annahme, dass alles das im Zweifel auch von potenziellen Arbeitgebern wahrgenommen wird – ungeachtet dessen, dass diese sich mit ihren Hintergrundrecherchen vielleicht in einem rechtlichen Graubereich bewegen. Wie ein Mantra kann man hier nur zur Sensibilität aufrufen. Denn sonst kann bei einem allzu sorglosen Umgang der witzig gemeinte Post, der politisch nicht ganz korrekte Kommentar oder das freizügige Partybild schon mal leicht zur Karrierebremse werden. Obacht also!
Bild: Pixabay